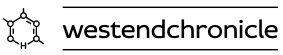Zusammen bilden abiotische und biotische Faktoren ein Ökosystem. Abiotische Faktoren sind die unbelebten Teile einer Umwelt. Dazu gehören Dinge wie Sonnenlicht, Temperatur, Wind, Wasser, Boden und natürlich auftretende Ereignisse wie Stürme, Brände und Vulkanausbrüche. Biotische Faktoren sind die lebenden Teile einer Umwelt, wie Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. Zusammen sind sie die biologischen Faktoren, die den Erfolg einer Art bestimmen. Jeder dieser Faktoren beeinflusst andere, und eine Mischung aus beidem ist notwendig, damit ein Ökosystem überleben kann.
TL; DR (zu lang; nicht gelesen)
Abiotische und biotische Faktoren bilden zusammen ein Ökosystem. Abiotische oder nicht lebende Faktoren sind solche wie Klima und Geographie. Biotische Faktoren sind lebende Organismen.
Abiotische oder nicht lebende Faktoren
Abiotische Faktoren können klimatisch, wetterbedingt oder edaphisch, bodenbezogen sein. Klimatische Faktoren sind Lufttemperatur, Wind und Regen. Zu den edaphischen Faktoren gehören Geographie wie Topographie und Mineralgehalt sowie Bodentemperatur, Textur, Feuchtigkeitsgehalt, pH-Wert und Belüftung.
Klimatische Faktoren haben großen Einfluss darauf, welche Pflanzen und Tiere in einem Ökosystem leben können. Vorherrschende Wettermuster und -bedingungen bestimmen die Bedingungen, unter denen die Arten voraussichtlich leben werden. Die Muster tragen nicht nur zur Schaffung der Umwelt bei, sondern wirken sich auch auf Wasserströmungen aus. Veränderungen dieser Faktoren, wie sie bei gelegentlichen Schwankungen wie El Niño auftreten, haben direkte Auswirkungen und können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben.
Änderungen der Lufttemperatur beeinflussen das Keimungs- und Wachstumsmuster von Pflanzen sowie das Migrations- und Winterschlafmuster bei Tieren. Während in vielen gemäßigten Klimazonen saisonale Veränderungen auftreten, können unerwartete Veränderungen negative Folgen haben. Obwohl sich einige Arten anpassen können, können plötzliche Veränderungen zu einem unzureichenden Schutz vor schweren Bedingungen führen (z. B. ohne Winterfell) oder ohne ausreichende Nahrungsvorräte für ein Jahreszeit. In einigen Lebensräumen, wie beispielsweise in Korallenriffen, können Arten möglicherweise nicht an einen gastfreundlicheren Ort migrieren. In all diesen Fällen sterben sie ab, wenn sie sich nicht anpassen können.
Edaphische Faktoren wirken sich stärker auf Pflanzenarten als auf Tiere aus, und die Wirkung ist auf größere Organismen größer als auf kleinere. Zum Beispiel beeinflussen Variablen wie die Höhe die Pflanzenvielfalt stärker als die von Bakterien. Dies zeigt sich in Waldbaumbeständen, bei denen die Höhe, die Neigung des Landes, die Sonneneinstrahlung und der Boden eine Rolle bei der Bestimmung des Bestands bestimmter Baumarten in einem Wald spielen. Auch biotische Faktoren spielen eine Rolle. Das Vorkommen anderer Baumarten hat einen Einfluss. Die Verjüngungsdichte von Bäumen ist tendenziell höher an Standorten, an denen andere Bäume der gleichen Art in der Nähe sind. In einigen Fällen ist das Vorhandensein bestimmter anderer Baumarten in der Nähe mit einem geringeren Regenerationsgrad verbunden.
Landmassen und Höhe beeinflussen Wind und Temperatur. Zum Beispiel kann ein Berg einen Windschutz erzeugen, der sich auf die Temperatur auf der anderen Seite auswirkt. Ökosysteme in höheren Lagen erfahren niedrigere Temperaturen als solche in niedrigeren Lagen. In extremen Fällen kann die Höhe sogar in tropischen Breiten zu arktischen oder subarktischen Bedingungen führen. Diese Temperaturunterschiede können es einer Art unmöglich machen, von einem geeigneten Umgebung zu einer anderen, wenn der Weg dazwischen das Reisen durch wechselnde Höhen mit unwirtlichen Bedingungen.
Mineralien wie Kalzium und Stickstoff beeinflussen die Verfügbarkeit von Nahrungsquellen. Der Gehalt an Gasen wie Sauerstoff und Kohlendioxid in der Luft bestimmt, welche Organismen dort leben können. Unterschiede im Gelände wie Bodenbeschaffenheit, Zusammensetzung und Größe der Sandkörner können sich ebenfalls auf die Überlebensfähigkeit einer Art auswirken. Zum Beispiel benötigen grabende Tiere bestimmte Arten von Gelände, um ihr Zuhause zu schaffen, und einige Organismen benötigen nährstoffreichen Boden, während andere in sandigem oder felsigem Gelände besser abschneiden.
In vielen Ökosystemen sind abiotische Faktoren saisonabhängig. In gemäßigten Klimazonen wirken sich normale Temperaturschwankungen, Niederschläge und die tägliche Sonneneinstrahlung auf die Wachstumsfähigkeit der Organismen aus. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf das Pflanzenleben, sondern auch auf die Arten, die auf die Pflanzen als Nahrungsquelle angewiesen sind. Tierarten können einem Aktivitäts- und Winterschlafmuster folgen oder sich durch Veränderungen von Fell, Ernährung und Körperfett an sich ändernde Bedingungen anpassen. Sich ändernde Bedingungen fördern hohe Diversitätsraten zwischen Arten in einem Ökosystem. Dies kann dazu beitragen, Populationen zu stabilisieren.
Unerwartete klimatische Ereignisse
Die Umweltstabilität eines Ökosystems wirkt sich auf die Population der Arten aus, die es beheimatet. Unerwartete Veränderungen können das Nahrungsnetz indirekt verändern, da veränderte Bedingungen es mehr oder weniger gastfreundlich machen und beeinflussen, ob sich eine bestimmte Art etablieren wird. Während viele abiotische Faktoren eher vorhersehbar auftreten, treten einige selten oder ohne Vorwarnung auf. Dazu zählen Naturereignisse wie Dürren, Stürme, Überschwemmungen, Brände und Vulkanausbrüche. Diese Ereignisse können einen großen Einfluss auf die Umwelt haben. Solange sie nicht in großer Häufigkeit oder auf einem zu großen Gebiet auftreten, haben diese Naturereignisse Vorteile. Bei optimalen Abständen können diese Ereignisse sehr vorteilhaft sein und die Umwelt verjüngen.
Längere Dürren wirken sich negativ auf ein Ökosystem aus. In vielen Gebieten können sich Pflanzen nicht an wechselnde Regenmuster anpassen und sterben ab. Dies betrifft auch Organismen weiter oben in der Nahrungskette, die gezwungen sind, in ein anderes Gebiet abzuwandern oder ihre Ernährung umzustellen, um zu überleben.
Stürme sorgen für den notwendigen Niederschlag, aber starker Regen, Graupel, Hagel, Schnee und starke Winde können Bäume und Pflanzen beschädigen oder zerstören, mit gemischten Umweltfolgen. Obwohl Organismen geschädigt werden können, kann diese Ausdünnung von Ästen oder Wäldern dazu beitragen, bestehende Arten zu stärken und Raum für das Wachstum neuer Arten zu schaffen. Andererseits können starke Regenfälle (oder schnelle Schneeschmelze) örtliche Erosion verursachen und das Stützsystem schwächen.
Überschwemmungen können von Vorteil sein. Hochwasser versorgt Pflanzen mit Nährstoffen, die sonst nicht genügend Wasser bekommen. Sedimente, die sich möglicherweise in Flussbetten abgesetzt haben, werden umverteilt und ergänzen die Nährstoffe im Boden, wodurch er fruchtbarer wird. Der neu abgelagerte Boden kann auch dazu beitragen, Erosion zu verhindern. Überschwemmungen verursachen natürlich auch Schäden. Hohe Fluten können Tiere und Pflanzen töten, und Wasserlebewesen können verdrängt werden und sterben, wenn das Wasser ohne sie zurückgeht.
Feuer hat auch sowohl schädliche als auch positive Auswirkungen auf ein Ökosystem. Pflanzen- und Tierleben können verletzt werden oder sterben. Der Verlust lebender Wurzelstrukturen kann zu Erosion und späterer Sedimentation von Wasserstraßen führen. Es können schädliche Gase produziert und von Winden getragen werden, die auch andere Ökosysteme beeinträchtigen. Potenziell schädliche Partikel, die in Wasserstraßen gelangen, können von Wasserlebewesen aufgenommen werden und sich negativ auf die Wasserqualität auswirken. Feuer kann jedoch auch einen Wald verjüngen. Es fördert neues Wachstum, indem es die Samenhüllen aufbricht und die Keimung auslöst oder indem es die Schoten im Kronendach dazu veranlasst, sich zu öffnen und Samen freizusetzen. Feuer räumt das Unterholz, reduziert die Konkurrenz um Setzlinge und bietet ein frisches, nährstoffreiches Beet für Samen.
Vulkanausbrüche führen zunächst zur Zerstörung, aber die nährstoffreichen vulkanischen Böden kommen später der Pflanzenwelt zugute. Andererseits kann ein Anstieg des Säuregehalts und der Temperatur des Wassers für Wasserlebewesen schädlich sein. Vögel können ihren Lebensraum verlieren und ihre Zugmuster können gestört werden. Eine Eruption zwingt auch mehrere Gase in die Atmosphäre, die den Sauerstoffgehalt beeinflussen und die Atemwege beeinträchtigen können.
Biotische oder lebende Faktoren
Alle lebenden Organismen, vom mikroskopischen Organismus bis zum Menschen, sind biotische Faktoren. Mikroskopische Organismen sind die am häufigsten vorkommenden und weit verbreitet. Sie sind sehr anpassungsfähig und ihre Reproduktionsraten sind schnell, sodass sie in kurzer Zeit eine große Population bilden können. Ihre Größe kommt ihnen zugute; sie können schnell über eine große Fläche verteilt werden, entweder durch abiotische Faktoren wie Wind oder Wasserströmungen oder durch Reisen in oder auf anderen Organismen. Die Einfachheit der Organismen trägt auch zu ihrer Anpassungsfähigkeit bei. Die für das Wachstum erforderlichen Bedingungen sind gering, sodass sie problemlos in einer größeren Vielfalt von Umgebungen gedeihen können.
Biotische Faktoren beeinflussen sowohl ihre Umwelt als auch sich gegenseitig. Das Vorhandensein oder Fehlen anderer Organismen beeinflusst, ob eine Art um Nahrung, Schutz und andere Ressourcen konkurrieren muss. Verschiedene Pflanzenarten können um Licht, Wasser und Nährstoffe konkurrieren. Einige Mikroben und Viren können Krankheiten verursachen, die auf andere Arten übertragen werden können, wodurch die Population verringert wird. Nützliche Insekten sind die Hauptbestäuber von Nutzpflanzen, aber andere haben das Potenzial, Nutzpflanzen zu zerstören. Insekten können auch Krankheiten übertragen, von denen einige auf andere Arten übertragen werden können.
Die Anwesenheit von Raubtieren beeinflusst das Ökosystem. Welche Auswirkungen dies hat, hängt von drei Faktoren ab: der Anzahl der Raubtiere in einer bestimmten Umgebung, wie sie mit Beutetieren interagieren und wie sie mit anderen Raubtieren interagieren. Die Existenz mehrerer Raubtierarten in einem Ökosystem kann sich gegenseitig beeinflussen oder nicht, je nachdem von der bevorzugten Nahrungsquelle, der Größe des Lebensraums und der Häufigkeit und Menge der Nahrung erforderlich. Die größte Wirkung wird erzielt, wenn zwei oder mehr Arten dieselbe Beute verzehren.
Dinge wie Wind oder Wasserströmungen können Mikroorganismen und kleine Pflanzen umsiedeln und ihnen ermöglichen, neue Kolonien zu gründen. Diese Verbreitung von Arten kann für das gesamte Ökosystem von Vorteil sein, da sie eine größere Nahrungsversorgung für die Primärverbraucher bedeuten kann. Es kann jedoch ein Problem sein, wenn etablierte Arten gezwungen sind, mit neuen um Ressourcen zu konkurrieren, und diese invasiven Arten übernehmen und das Gleichgewicht des Ökosystems stören.
In einigen Fällen können biotische Faktoren abiotische Faktoren daran hindern, ihre Arbeit zu erledigen. Eine Überpopulation einer Art kann abiotische Faktoren beeinflussen und andere Arten negativ beeinflussen. Selbst der kleinste Organismus, wie Phytoplankton, kann ein Ökosystem zerstören, wenn er sich überbevölkern lässt. Dies zeigt sich bei „Braunalgenblüten“, bei denen sich übermäßig viele Algen auf der Oberfläche des Bodens ansammeln Wasser und verhindern, dass das Sonnenlicht den Bereich darunter erreicht, wodurch alles Leben unter der Oberfläche effektiv abgetötet wird Wasser. An Land wird eine ähnliche Situation beobachtet, wenn ein Baumkronendach eine große Fläche bedeckt und die Sonne effektiv daran hindert, die darunter liegende Pflanzenwelt zu erreichen.
Extreme Umgebungsbedingungen
Die Arktis und Antarktis haben nicht nur extrem kalte Temperaturen, sondern diese Temperaturen variieren auch je nach Jahreszeit. Am Polarkreis ermöglicht die Erdrotation, dass nur wenig Sonne die Oberfläche erreicht, was zu einer kurzen Vegetationsperiode führt. Beispielsweise beträgt die Vegetationsperiode im Arctic National Wildlife Refuge nur 50 bis 60 Tage bei einem Temperaturbereich von 2 bis 12 Grad Celsius. Da der Polarkreis von der Sonne abgewandt ist, haben die Winter kurze Tage mit Temperaturen von -34 bis -51 Grad Celsius (-29 bis -60F). Starke Winde (bis zu 160 km/h oder etwa 100 Meilen pro Stunde) bewerfen ausgesetzte Pflanzen und Tiere mit Eiskristallen. Während die Schneedecke isolierende Vorteile bietet, lassen die extremen Bedingungen kein neues Pflanzenwachstum zu.
Biotische Faktoren sind in der Arktis selten. Die Bedingungen lassen nur tief liegende Pflanzen mit flachen Wurzelstrukturen zu. Die meisten von ihnen haben dunkelgrüne bis rote Blätter, die mehr Sonnenlicht absorbieren und sich asexuell durch Knospen oder Klonen und nicht sexuell über Samen vermehren. Die meisten Pflanzen wachsen direkt über dem Permafrostboden, da der Boden mehrere Zentimeter darunter liegt. Aufgrund des sehr kurzen Sommers vermehren sich Pflanzen und Tiere schnell. Viele Tiere sind wandernd; Diejenigen, die im Arctic National Wildlife Refuge leben, haben in der Regel kleinere Anhängsel und größere Körper als ihre südlichen Gegenstücke, die es ihnen ermöglichen, warm zu bleiben. Die meisten Säugetiere haben auch eine isolierende Fettschicht und einen Schutzmantel, der Kälte und Schnee widersteht.
Beim anderen Temperaturextrem stellen trockene Wüsten auch biotische Faktoren vor Herausforderungen. Lebende Organismen brauchen Wasser, um zu überleben, und die abiotischen Faktoren in einer Wüste (Temperatur, Sonnenlicht, Topographie und Bodenzusammensetzung) sind für alle bis auf wenige Arten unwirtlich. Der Temperaturbereich der meisten großen amerikanischen Wüsten liegt zwischen 20 und 49 Grad Celsius (68 bis 120F). Die Niederschlagsmengen sind niedrig und die Niederschläge sind uneinheitlich. Der Boden neigt dazu, grob und steinig zu sein, mit wenig bis gar keinem Untergrundwasser. Es gibt wenig bis gar keinen Baldachin und das Pflanzenleben ist in der Regel kurz und spärlich. Auch die Tierwelt ist tendenziell kleiner, und viele Arten verbringen ihre Tage in einem Bau und tauchen nur in den kühleren Nächten auf. Während diese Umgebung für Sukkulenten wie Kakteen günstig ist, überleben poikilohydrische Pflanzen, indem sie zwischen Regenfällen einen Ruhezustand beibehalten. Nach einem Regen werden sie photosynthetisch aktiv und vermehren sich schnell, bevor sie wieder den Ruhezustand einnehmen.