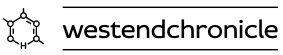Auf den ersten Blick ist die Idee des Welle-Teilchen-Dualismus in der Tat seltsam. Sie haben wahrscheinlich schon etwas über Wellen gelernt und wissen, dass sie eine Störung in einem Medium sind, und Sie haben wahrscheinlich etwas über Teilchen gelernt, bei denen es sich um diskrete physikalische Objekte handelt. Die Vorstellung, dass einige Dinge Eigenschaften von beiden haben, mag also nicht nur seltsam erscheinen, sondern physikalisch unmöglich.
Dieser Artikel führt Sie in die Idee der Welle-Teilchen-Dualität ein und gibt einen Überblick über die Entstehung des Konzepts und wie sich herausstellt, dass es in vielen Fällen eine ausgezeichnete Beschreibung der Realität ist, insbesondere im Bereich der Quanten Physik.
Wellen und wellenartige Eigenschaften
Beginnen wir mit der Betrachtung dessen, was eine Welle ausmacht. Eine Welle ist definiert als eine Störung in einem Medium, die sich von einem Ort zum anderen ausbreitet und dabei Energie überträgt, aber keine Masse.
In dem Medium, durch das sich die Welle bewegt, schwingen die einzelnen Moleküle einfach auf der Stelle. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Menschenmenge in einem Stadion, die „die Welle“ macht. Jeder einzelne steht einfach auf und setzt sich hin und her, während die Welle selbst durch das gesamte Stadion wandert.
Zu den Welleneigenschaften gehören Wellenlänge (der Abstand zwischen Wellenspitzen), Frequenz (die Anzahl der Wellenzyklen pro Sekunde), Periode (die Zeit, die für einen vollständigen Wellenzyklus benötigt wird, und Geschwindigkeit (wie schnell sich die Störung ausbreitet).
Partikeleigenschaften und Partikelnatur
Partikel sind verschiedene physikalische Objekte. Sie haben eine genau definierte Position im Raum, und wenn sie sich von einem Ort zum anderen bewegen, übertragen sie nicht nur Energie, sondern auch ihre eigene Masse.
Im Gegensatz zu Wellen brauchen sie kein Medium, durch das sie sich bewegen können. Es macht auch keinen Sinn, sie mit einer Wellenlänge, Frequenz und Periode zu beschreiben. Stattdessen werden sie normalerweise durch ihre Masse, Position und Geschwindigkeit beschrieben.
Welle-Teilchen-Dualität und elektromagnetische Strahlung
Wenn der Phänomen des Lichts erstmals untersucht wurde, waren sich die Wissenschaftler nicht einig, ob es sich um eine Welle oder ein Teilchen handelte. Isaac Newtons korpuskulare Beschreibung des Lichts behauptete, es handle sich um ein Teilchen, und er entwickelte Ideen das erklärte Reflexion und Brechung innerhalb dieses Rahmens, obwohl einige seiner Methoden dies nicht ganz schienen Arbeit.
Christiaan Huygens widersprach Newton und benutzte die Wellentheorie, um Licht zu beschreiben. Er konnte Reflexion und Brechung erklären, indem er Licht als Welle behandelte.
Das berühmte Doppelspaltexperiment von Thomas Young, das Interferenzmuster in rotem Licht im Zusammenhang mit wellenförmigem Verhalten zeigte, unterstützte auch die Wellentheorie.
Die Debatte, ob Licht ein Teilchen oder eine Welle ist, schien gelöst zu sein, als James Clerk Maxwell auf den Plan trat und Licht über seine Maxwell-Gleichungen als elektromagnetische Wellen beschrieb.
Es stellte sich jedoch bald heraus, dass die Wellennatur des Lichts nicht alle beobachteten Phänomene berücksichtigte. Der photoelektrische Effekt zum Beispiel ließe sich nur erklären, wenn man Licht wie ein Teilchen behandelte – als einzelne Photonen oder Lichtquanten. Diese Idee stammt von Albert Einstein, der dafür den Nobelpreis erhielt.
So wurde die Idee der Welle-Teilchen-Dualität geboren. Licht konnte nur dann wirklich erklärt werden, wenn es in manchen Situationen als Welle und in anderen als Teilchen behandelt würde.
Welle-Teilchen-Dualität und Materie
Hier wird es noch seltsamer. Nicht nur Licht zeigt diese Dualität, sondern auch die Materie. Dies wurde von Louis de Broglie entdeckt.
Diese Dualität ist im makroskopischen Maßstab gar nicht zu erkennen, aber wenn es um die Arbeit mit elementaren Teilchen scheinen sie manchmal als Teilchen und manchmal als Wellen zu wirken, wobei ihre Wellenlänge gleich der. ist damit verbundenen de Broglie-Wellenlänge.
Diese Vorstellung führte zur Entwicklung der Quantenmechanik, die Teilchen mit Wellenfunktionen beschreibt, die dann im Sinne der Schrödinger-Gleichung verstanden werden können.