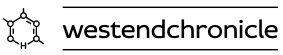Die Atomtheorie hat sich seit der Antike entwickelt. Wissenschaftler haben die Hypothese griechischer Gelehrter übernommen und mit ihren unterschiedlichen Entdeckungen und Theorien über das Atom, das vom griechischen Wort "atomos" abgeleitet ist, was bedeutet unteilbar. Seitdem hat die wissenschaftliche Gemeinschaft entdeckt, dass sich diese Teilchen weiter in Unterteilchen namens Protonen, Neutronen und Elektronen aufteilen. Trotzdem ist der Name "Atom" geblieben.
Altgriechischer Glaube
Leukipp und Demokrit waren die ersten, die im fünften Jahrhundert v. Die beiden Philosophen hielten dies für feste Teilchen ohne innere Struktur und kamen in verschiedenen Formen und Größen vor. Immaterielle Eigenschaften wie Geschmack und Farbe bestanden dieser Theorie zufolge aus Atomen. Aristoteles lehnte diese Idee jedoch entschieden ab, und die wissenschaftliche Gemeinschaft schenkte ihr jahrhundertelang keine ernsthafte Aufmerksamkeit.
Daltons Theorie
1808 baute der englische Chemiker John Dalton weiter auf dem griechischen Atombegriff auf. Er postulierte, dass Materie aus Atomen besteht, die kleine unteilbare Teilchen sind. Er schlug auch vor, dass, obwohl alle Atome eines Elements identisch sind, sie sich völlig von denen unterscheiden, aus denen andere Elemente bestehen.
J. J. Thomsons Theorie
Der englische Physiker Joseph J. Thomson schlug 1904 die "Plum Pudding"-Theorie des teilbaren Atoms vor, nachdem er 1897 Elektronen entdeckt hatte. Sein Modell postulierte, dass Atome aus einer großen, positiv geladenen Kugel bestehen, die mit negativ geladenen Elektronen besetzt ist (er nannte sie "Körperchen") wie Früchte in einem Plumpudding. Er stellte weiterhin die Hypothese auf, dass die Ladung der positiven Kugel gleich der negativen Ladung der Elektronen ist. Heute nennen wir die positiv geladenen Teilchen Protonen und die negativen Elektronen.
Rutherfords Hypothese
Der britische Physiker Ernest Rutherford schlug 1911 ein Kernmodell des Atoms vor, in dem ein Kern existiert. Er entdeckte auch Aktivität in diesem Teil, nämlich die Bewegung von Protonen und Elektronen innerhalb des zentralen Teils des Atoms. Er postulierte weiter, dass die Anzahl der Protonen in einem Atom gleich der der Elektronen ist. Er stellte auch die Hypothese auf, dass es mehr neutrale Teilchen gibt. Diese sind als Neutronen bekannt.
Bohrs Theorie
Der dänische Physiker Niels Bohr schlug 1913 ein Planetenmodell vor, bei dem Elektronen um den Kern kreisen, so wie die Planeten die Sonne umkreisen. Während sich die Elektronen in der Umlaufbahn befinden, haben sie das, was Bohr als "konstante Energie" bezeichnete. Wenn diese Partikel Energie absorbieren und in eine höhere Umlaufbahn übergehen, bezeichnet Bohrs Theorie sie als "erregt". Elektronen. Wenn die Elektronen auf ihre ursprüngliche Umlaufbahn zurückkehren, geben sie diese Energie als elektromagnetische Strahlung ab.
Einstein, Heisenberg und Quantenmechanik
Aus jahrzehntelanger sorgfältiger Forschung von Tausenden von Wissenschaftlern baut die aktuelle Atomtheorie auf Arbeiten von Albert Einstein, Werner Heisenberg und anderen in den 1930er Jahren auf. Wie bei den früheren Theorien besteht das Atom aus einem zentralen, schweren Kern, der von einer Reihe von Elektronen umgeben ist. Im Gegensatz zu früheren Theorien, die Elektronen, Protonen und andere winzige Teilchen als bestimmte feste "Klumpen" behandelten, ist die moderne Quantentheorie behandelt sie als statistische "Wolken"; Seltsamerweise können Sie ihre Geschwindigkeit oder ihre Position genau messen, aber nicht beides gleichzeitig Zeit. Anstatt sich wie Planeten zu verhalten, die auf wohlerzogenen elliptischen Bahnen kreisen, wirbeln sie in unscharfen Wolken unterschiedlicher Form herum. Atome werden dann weniger wie harte, präzise Billardkugeln, sondern eher wie federnde, runde Schwämme. Und obwohl sie "fester" Stoff sind, können sie wellenartige Eigenschaften wie Wellenlänge und Interferenzmuster aufweisen.
Quark-Theorie
Als Wissenschaftler Atome mit immer leistungsfähigeren Instrumenten untersuchten, entdeckten sie, dass die Protonen und Neutronen, aus denen der Kern bestand, wiederum aus noch kleineren Teilchen bestanden. In den 1960er Jahren nannten die Physiker Murray Gell-Mann und George Zweig diese Teilchen "Quarks", in Anlehnung an ein Wort aus einem Roman von James Joyce. Quarks gibt es in Varianten wie „up“, „down“, „top“ und „bottom“. Protonen und Neutronen werden aus Bündeln von jeweils drei Quarks gebildet: „up“, „down“ und „up“ bzw. „down“, „up“ und „down“.